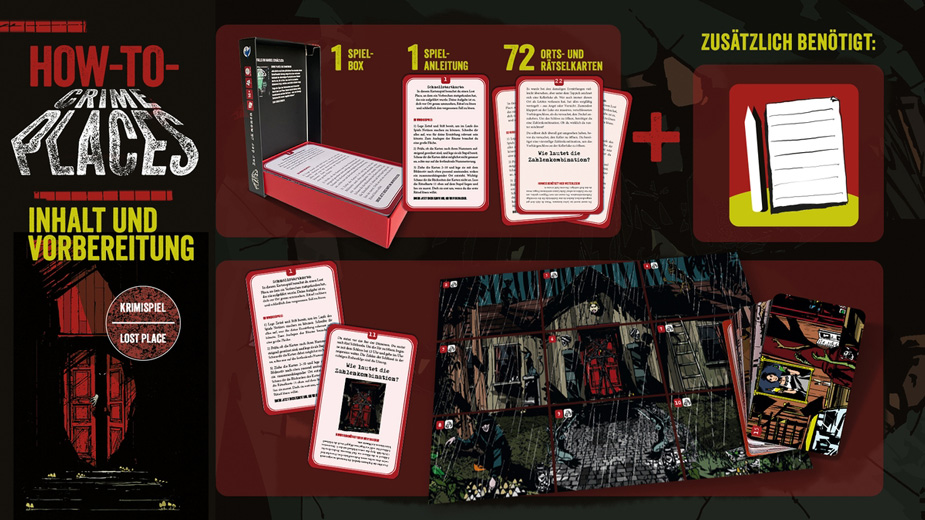GESELLSCHAFTSSPIELE
| 31.10.2025
Crime
Places
Das neue kartenbasierte Rätselspiel von Oetinger
Mit
„Crime Places – Das Sanatorium“ und „Crime
Places – Bar der Dämonen“ erfindet sich das Krimi-Kartenspiel
neu – als erzählerisch dichte, atmosphärisch aufgeladene
Erfahrung zwischen Rätsel, Psychodrama und Mystery. Zwei Lost
Places, zwei Abgründe – und ein Spiel, das tiefer geht
als viele Filme.
von
Franziska Keil

©
Verlagsgruppe Oetinger Service GmbH
Als
am 9. Oktober die beiden Kartenspiele „Crime Places –
Das Sanatorium“ und „Crime Places – Bar der Dämonen“
erschienen sind, öffnete sich für Krimi- und Mysteryliebhaber
ein Tor in eine Welt, in der Neugier zur Mutprobe wird und das Lösen
von Rätseln einem nächtlichen Abstieg in vergessene Abgründe
gleicht. Die Autoren Hans Pieper und Joel Müseler sowie Illustrator
Tim Möller-Kaya schaffen mit dieser neuen Reihe nicht nur eine
weitere Variation des beliebten Escape-Game-Formats, sondern eine
atmosphärische Fusion aus Krimi, Psychothriller und immersivem
Storytelling, die das Genre der Rätselspiele mit filmischer Intensität
auflädt.
Beide
Titel der Reihe führen die Spielenden an Orte, die ihre eigene
morbide Poesie entfalten: verlassene Gebäude, verrottete Erinnerungen,
das Echo längst vergangener Schreie. „Lost Places“
sind mehr als Kulissen – sie sind Erinnerungsträger kollektiver
Ängste, Schauplätze der Vergänglichkeit und des unaussprechlich
Unheimlichen. In „Das Sanatorium“ hallt der Wind durch
verlassene Gänge, in denen die Geschichte eines verschwundenen
Mädchens über Jahrzehnte hinweg nachzittert. „Bar
der Dämonen“ hingegen spielt mit den Schatten der Vergangenheit
eines Serienmörders, dessen Verbrechen sich zwischen Realität,
Ritual und Wahn bewegen. Der Clou der Spiele liegt in ihrer Kartenstruktur:
Jede der 72 Karten öffnet ein neues Kapitel, enthüllt Spuren,
Hinweise und narrative Verästelungen, die sich zu einem vielschichtigen
Mosaik verweben. Dabei bleibt der materielle Minimalismus –
nur ein Kartendeck – im reizvollen Kontrast zur gedanklichen
Weite, die sich entfaltet. Es ist ein Beweis, dass Immersion keine
Virtual-Reality-Brille benötigt, sondern allein durch kluges
Erzählen und die Vorstellungskraft der Spielenden entsteht.
Was
die „Crime Places“-Reihe von vielen anderen Krimi- und
Escape-Spielen unterscheidet, ist ihr literarischer Anspruch. Pieper
und Müseler konzipieren ihre Fälle weniger als Rätselmechanismen,
sondern als narrative Räume, die sich mit jedem Hinweis psychologisch
verdichten. Das Spielerlebnis ist kein bloßes Kombinieren von
Indizien, sondern ein allmähliches Eindringen in die mentale
Topographie der Tatorte – eine Form des immersiven Erzählens,
das an die Sogwirkung moderner Mystery-Serien erinnert. In „Das
Sanatorium“ weht ein Hauch von Nordic Noir durch die ruinösen
Gänge, eine Atmosphäre aus Kälte, Schuld und gebrochener
Erinnerung. Die Story um die verschwundene Schulfreundin Solveig ist
weniger ein klassischer Kriminalfall als eine melancholische Meditation
über Erinnerung und Verdrängung. In „Bar der Dämonen“
hingegen treibt das Okkulte seine Blüten – hier mischen
sich Dämonenglaube, Schuldprojektion und kollektiver Wahn zu
einem hypnotischen Spiel aus Halluzination und Wahrheit, das an die
Grenzerfahrungen von „Twin Peaks“ oder „True Detective“
denken lässt.
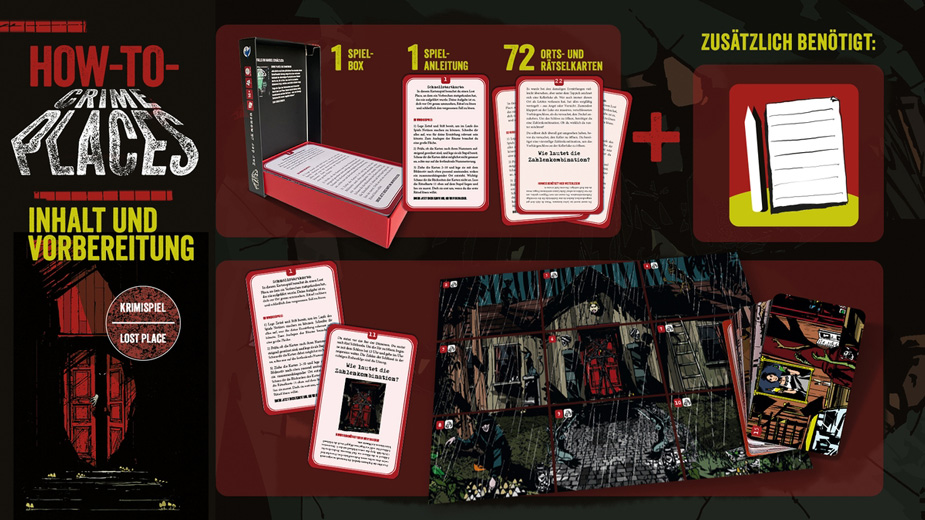
©
Verlagsgruppe Oetinger Service GmbH
Die
besondere Stärke der beiden Spiele liegt in ihrer Fähigkeit,
Atmosphäre durch Auslassung zu schaffen. Wie in einem guten Psychothriller
liegt die Faszination nicht im Schockmoment, sondern im, was man nicht
sieht – oder noch nicht zu verstehen wagt. Tim Möller-Kayas
Illustrationen leisten hierzu einen entscheidenden Beitrag: seine
Detailgenauigkeit im Morbiden, seine brüchigen Lichtverhältnisse
und das Spiel mit Schatten und Leere verleihen den Karten eine fast
filmische Textur. Jede Zeichnung ist Einladung und Warnung zugleich
– ein Standbild aus einem Albtraum, in dem man selbst die nächste
Entscheidung treffen muss. Dass beide Spiele mehrfach spielbar sind,
ist dabei keine formale Nebensächlichkeit, sondern Ausdruck ihrer
narrativen Offenheit. Je nach Entscheidung, Wahrnehmung und Interpretation
ergeben sich neue Lesarten, neue psychologische Perspektiven auf die
Ereignisse.
Die
„Crime Places“-Reihe lebt vom Balanceakt zwischen Authentizität
und Fiktion. Die Verbrechen wirken real genug, um Gänsehaut auszulösen,
aber nie so voyeuristisch, dass sie in Sensationslust kippen. Vielmehr
geht es um den forensischen Blick als Metapher – um das Ergründen
des Verborgenen, das Aufdecken jener inneren Landschaften, in denen
die wahren Verbrechen schlummern: Selbsttäuschung, Schweigen,
Schuld. Dass die Spiele ohne aufwendige Regeln auskommen und sich
auch allein erleben lassen, ist kein Zugeständnis an Bequemlichkeit,
sondern ein bewusster Schachzug: Das Rätseln wird zur intimen,
fast kontemplativen Erfahrung. In der Einsamkeit des Spieltischs,
umgeben von Schweigen und Dunkelheit, entfalten die Karten ihre ganze
suggestive Kraft – man liest sie nicht, man betritt sie.
Fazit
„Crime
Places – Das Sanatorium“ und „Crime Places –
Bar der Dämonen“ sind zwei Seiten derselben dunklen Medaille:
das Rational-Psychologische und das Okkult-Albtraumhafte. Beide Titel
beweisen, dass die Gattung der Krimi-Kartenspiele zu wahrer Kunstform
reifen kann, wenn sie sich nicht mit bloßen Puzzles begnügt,
sondern eine emotionale und ästhetische Erfahrung erzeugt. In
einer Zeit, in der Spiele oft auf Effekt und Tempo setzen, wagen Pieper,
Müseler und Möller-Kaya das Gegenteil: Sie verlangsamen,
vertiefen, lassen Stille zu. Ihre „Crime Places“-Reihe
ist ein Plädoyer für die Kunst des genauen Hinsehens, für
die Schönheit des Unheimlichen – und für die Erkenntnis,
dass jeder Lost Place letztlich ein Spiegel des eigenen Inneren ist.
CRIME
PLACES
Das
Sanatorium | Bar der Dämonen
Dauer:
ca. 120-180 Min.; Alter: 16-99 Jahre; Personenanzahl: ab 1 Person;
mehrfach spielbar, die Karten bleiben intakt.
Verlagsgruppe
Oetinger
|
|
|
|