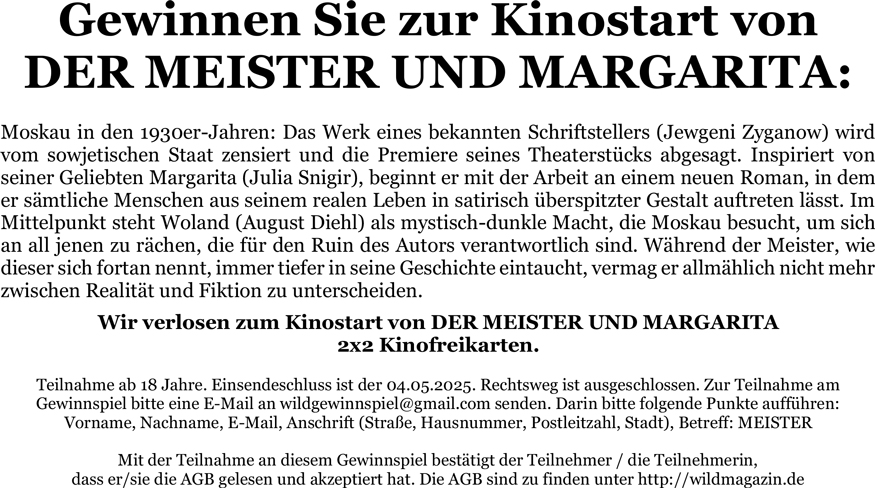KINO | 30.04.2025DER MEISTER UND MARGARITA
Moskau in den 1930er-Jahren: Das Werk eines bekannten Schriftstellers wird vom sowjetischen Staat zensiert und die Premiere seines Theaterstücks abgesagt. Inspiriert von seiner Geliebten Margarita, beginnt er mit der Arbeit an einem neuen Roman, in dem er sämtliche Menschen aus seinem realen Leben in satirisch überspitzter Gestalt auftreten lässt.
von Laura Sternberg

© CAPELIGHT PICTURES
Kaum ein Roman wurde so oft als „unverfilmbar“ beschrieben wie Michail Bungalows „Der Meister und Margarita“. Und vielleicht - das gibt die nun erschienene Verfilmung unter Regisseur Michael Lockshin zu denken - sollte man manche Geschichten tatsächlich einfach in ihrer ursprünglichen Form belassen. Was der Film „Der Meister und Margarita“ versucht, ist zweifellos ehrgeizig: die Verwendung einer Vielzahl von Handlungsebenen, die Reflexion über Gut und Böse, dystopische Gesellschaftskritik und nicht zuletzt ein oft recht wilder Bildersturm zwischen fantasievoller Satire und existenzieller Tragödie.
Die Geschichte entfaltet sich, wie im Buch so auch im Film, in mehreren Ebenen: In einem atheistischen Moskau der 1930er Jahre erscheint eines Tages der mysteriöse Ausländer Woland (August Diehl) - der Teufel selbst - und bringt mit seinem höllischen Gefolge das öffentliche Leben aus den Fugen. Parallel dazu wird die Liebesgeschichte zwischen dem verzweifelten Schriftsteller, dem „Meister“ (Yevgeny Tsyganov), und seiner Geliebten Margarita (Yuliya Snigir) erzählt, die alles opfert, um ihren Geliebten aus dem Irrenhaus zu befreien. Eine weitere Ebene führt das Publikum zurück in die Zeit Jesu und erzählt die Begegnung von Pontius Pilatus und Jeschua Ha-Nostri. Es gibt zahlreiche Ankerpunkte die die Stränge miteinander verbinden, für mich ist jedoch letztendlich der gesamte Film zu einem visuellen und erzählerischen Fiebertraum verschwommen.

© CAPELIGHT PICTURES
Zu oft verliert sich die Inszenierung in Selbstgefälligkeit. Viele Einstellungen scheinen beweisen zu wollen, wie virtuos Kamera, Ausstattung und CGI-Effekte sein können. Überladen mit Symbolik, übermäßigen Farben und opulenten Sets, wirkt vieles eher wie ein loses Nebeneinander von Effekten und nicht wie ein dramaturgisch schlüssiges Ganzes. So können auch Szenen, wie eine große Bühnenaufführung von Woland, die alleinstehend durchaus ihren Reiz haben, nicht nachhaltig wirken. Auch die Figuren waren für mich wenig greifbar. Der Film setzt nicht auf eine zentrale Ankerfigur, sondern versucht vielmehr alle Figuren mythisch zu überhöhen und menschlich zu brechen, schafft aber weder das eine noch das andere konsequent. Die Liebesgeschichte zwischen Meister und Margarete etwa, die eigentlich der emotionale Kern der Handlung sein sollte, bleibt bruchstückhaft und letztlich blutleer. Man muss dem Film zugutehalten, dass er sich nicht anbiedern will. Er beugt sich nicht der Gefahr, Bulgakows Werk zu banalisieren oder zu glätten. Aber diese Ehrfurcht erstickt ihn teilweise auch: Statt eine eigene Interpretation zu wagen, will „Der Meister und Margita“ zu viel auf einmal – und verliert dabei Struktur, Fokus und emotionale Tiefe.
Am Ende bleibt „Der Meister und Margita“ ein faszinierendes, aber enttäuschendes Experiment. Wer bereit ist, sich auf das Chaos einzulassen, wird in einzelnen Szenen wahre filmische Perlen entdecken. Wer aber nach einer kohärenten, berührenden Adaption sucht, wird den Kinosaal eher ernüchtert verlassen.
 |
|
|
DER MEISTER UND MARGARITA Start:
01.05.25 | FSK 12 |
|